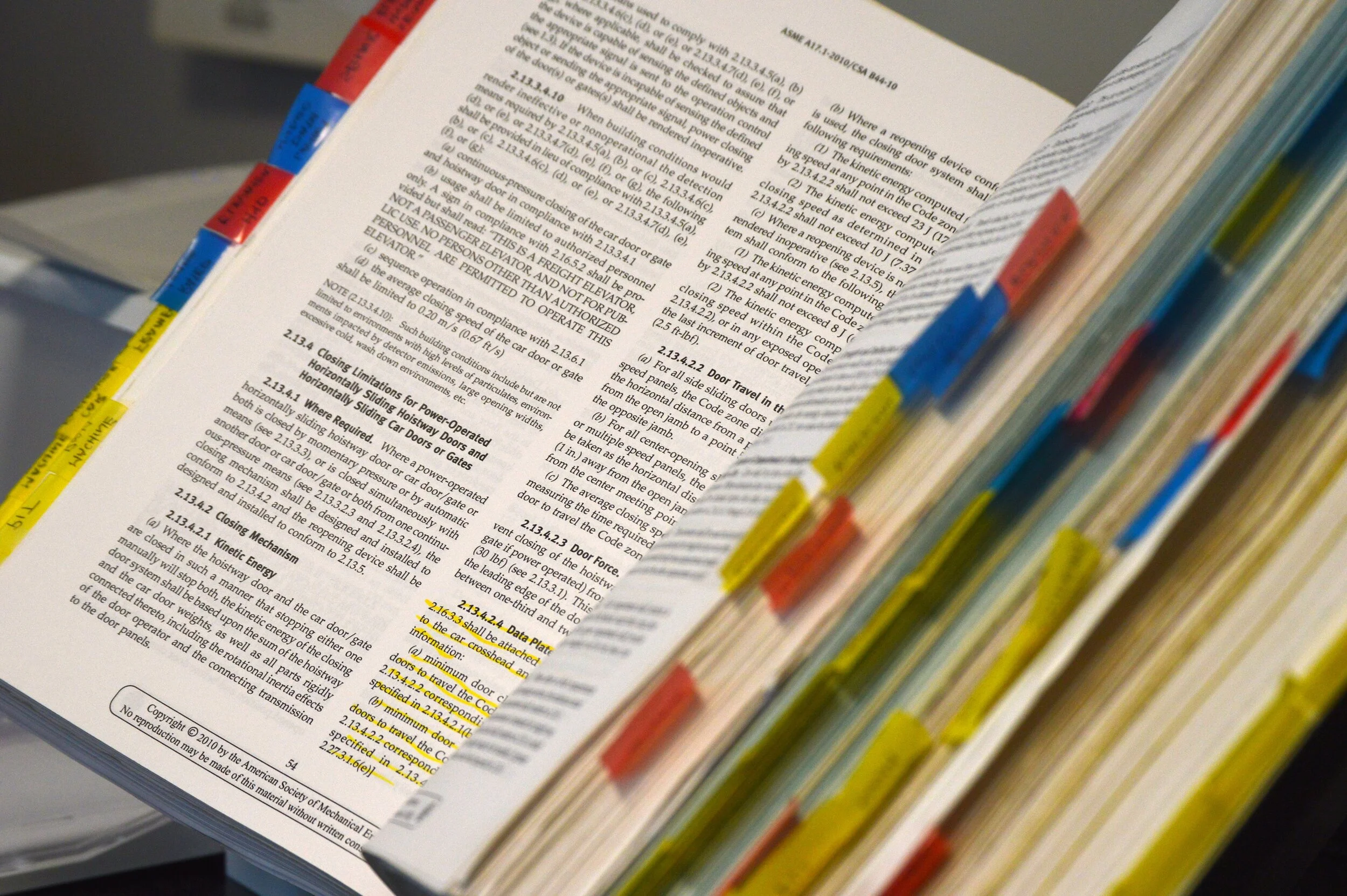Interview mit Prof. Dr. Martin Högl: “Der Mensch ist mehr als ein Eigennutzmaximierer”
Als ich meine Kopfhörer für das Interview aufsetzte, spürte ich meinen Herzschlag in den Ohren pochen. Mein Interviewpartner war schließlich jemand, der mit seiner Arbeit zu Teams, Führung und Innovation schon seit den späten 90ern für bereichernde, neue Erkenntnisse sorgt.
Martin Högl ist zuvorkommend, höflich und begegnete unserem Gespräch mit großer Offenheit. Er lässt für eine Erklärung gerne einmal eine Metapher einfließen, ist reflektiert in seinen Antworten und sagt geradeheraus, was ihm wichtig ist. Wir sprachen über Qualitäten von Teams, die Überwindung interkultureller Distanzen und darüber, was eine gute Führungskraft ausmacht.
Prof. Dr. Martin Hoegl
Hallo Herr Högl, mein erster Kontakt mit Ihrer Arbeit war das Konzept der Team Work Quality (TWQ), das sie mit Ihrem damaligen Professor, Jörg Gemünden, beschrieben haben. Wie kam es zu dieser Arbeit?
Während meines Masterstudiums für einen MBA in den Vereinigten Staaten gab es immer wieder Aufgaben, die als Team zu erledigen waren. Damals trieb mich schon die Frage um, warum es mit einigen Teams gut funktioniert und mit anderen weniger. Was macht die Qualität eines Teams aus?
Mit Jörg Gemünden hatte ich dann jemanden gefunden, der sich für ähnliche Themen interessierte und meine Doktorarbeit in Karlsruhe betreuen wollte. Wir haben dann auch verschiedene Faktoren entdeckt, wie gegenseitige Unterstützung, Kommunikation und individueller Anstrengung, die TWQ beschrieben.
Die Frage nach Qualität in Teams hat mich bis heute nicht mehr losgelassen. Bisher haben mein Team und ich vermutlich über 2.000 Teams weltweit in verschiedensten Organisationen und Kontexten interviewt und untersucht.
Bild von Sharon Mccutcheon auf Unsplash
Wenn wir weiter in die Qualität von Teams eintauchen, was interessiert sie daran zur Zeit besonders?
In den letzten Jahren interessiert mich interkulturelle Distanz. Zum Beispiel wie es Teams mit Hilfe von multikulturellen Individuen gelingt, kulturelle Unterschiede zu überbrücken? Dafür gibt es eine Diversitäts-Skala, die von 0 bis 1 geht. Bei einer 0 wären sie, wenn sie zum Beispiel in einem Ort in Montana aufwüchsen und diesen auch ihr ganzes Leben lang nicht verlassen würden. Näher einer 1 wären Sie, wenn Sie mit zwei unterschiedlichen Kulturen aufwüchsen und diese auch verkörperten.
Viele Personen begreifen ihre Diversität noch nicht als Ressource. Es scheint aber so zu sein, dass genau diese Menschen für ein Unternehmen sehr wertvoll sein können, da sie, richtig eingesetzt, Silos aufbrechen und Brücken bauen können.
Das erinnert mich an die Forschung des Neurologen Boris Cyrulnik, der sich mit der kulturellen Integration von Flüchtlingen aus Vietnam in Frankreich beschäftigte. Kann eine Person nur über Integration auf interkulturelle Ressourcen zurückgreifen?
Es kommt sehr auf den Kontext an, wie ein Individuum persönliche Ressourcen freisetzt. Dabei ist Integration nicht immer der beste Weg. Ich kann an dieser Stelle auf die Arbeit meiner geschätzten Kollegin Stacey Fitzsimmons verweisen. Sie beschäftigt sich in British Columbia mit den verschiedenen Strategien multikultureller Diversität.
Neben den Teams fasziniert Sie auch das Thema Innovation. Welcher Frage gingen Sie zu diesem Thema nach?
Über längere Zeit haben wir uns zum Beispiel mit der Frage “Ist weniger wirklich mehr?” beschäftigt. Wir haben geschaut, ob Teams tatsächlich innovativer sein können, wenn sie weniger Ressourcen zur Verfügung haben. Stellen Sie sich vor, ein guter Freund ruft Sie zu Hause an und kommt überraschend in einer Stunde zum Essen vorbei. Sie sind dann wahrscheinlich recht kreativ mit den zehn Dingen, die Sie im Kühlschrank haben. Erwischt Sie der gute Freund im Supermarkt, haben Sie die Qual der Wahl, was, zusammen mit dem Zeitdruck, lähmend wirken kann und sie letztlich einfach das machen, was sie sonst auch immer tun.
Tatsächlich fanden wir heraus, dass limitierte Ressourcen in der frühen Entwicklungsphase einer neuen Idee kreativitätsfördernd sein können. Sobald ein Prototyp steht und es um die Skalierung geht, ist es besser, wenn auch adäquate Ressourcen zur Verfügung stehen. Zwar sagt man gerade immer auch im Startup-Bereich “Fail fast!” und “Fail first!”, doch kommt es vielmehr darauf an, aus diesen Fehlern auch nachhaltig Lehren zu ziehen – und das ist keineswegs immer leicht.
Wenn wir jetzt schon vom Scheitern reden, liegt das Thema Resilienz nahe. In einem Ihrer Reviews aus dem Jahr 2019 ging es darum, wie Menschen mit Krisensituationen umgehen. Was reizt Sie an der Resilienzforschung?
Wir beforschen das Thema Resilienz schon seit über 10 Jahren – also bevor es zum Schlagwort wurde. Aktuell schauen wir uns z. B. auch Resilienz von Studierenden an. Die Wissenschaft hat sich bei Studierenden in den MINT Fächern stark mit den Gründen für einen Studienabbruch auseinandergesetzt. Das war gut und wichtig. Mich trieb allerdings die Frage um, was mit denen ist, die durchziehen.
Dafür begleiten wir Studierende über mehrere Semester. Wir sammeln die Art und Anzahl der Rückschläge, wie Umzugsstress, das Ende einer Beziehung, Scheitern in einer Prüfung oder an den eigenen Ansprüchen. In den Daten suchen wir dann nach den Qualitäten der Individuen und Qualitäten im Kontext der Studierenden.
Ein Punkt ist mir dabei besonders wichtig. In der Resilienzdebatte wird schnell mit dem Finger auf einzelne Menschen gezeigt. Getreu dem Motto “ist die Herausforderung zu stark, bist Du zu schwach”. Das ist eine viel zu verkürzte Sichtweise und entspricht nicht immer der Wahrheit. Vielmehr ist es wichtig, den Kontext zu betrachten und auch zu schauen, wie Menschen und Teams durch Phasen mit großen Rückschlägen geführt werden.
Gerade in der Wissenschaft gibt es ständig Rückschläge. Da ist es umso wichtiger, dass man nicht mit dieser Resilienzlogik die ganze Bürde für ein Scheitern auf das Individuum legt. Für mich ist viel interessanter, wie wir das Gesamtkonstrukt außen herum stricken.
In einer Studie haben wir eine Palliativstation im Krankenhaus untersucht. Es war faszinierend zu erfassen, wie das gesamte Team auf der Station, von der Putzkraft bis zur Chefärztin, bestärkende Mechanismen, Riten und Rituale pflegte. Wir erlebten Achtsamkeit, Umsicht, bewusstes Steuern von Emotionen und eine starke Interaktion der Menschen, so dass das Team selbst ein entscheidender Resilienzfaktor für die einzelnen Personen wurde.
Sie haben beim Thema ganzheitliche Resilienz auch die Führungsebene angesprochen. Wie hat sich das Bild einer Führungskraft in Deutschland seit dem Beginn Ihrer Forschung in den 90ern verändert?
Bild von Markus Spiske auf Unsplash
Wenn ich heute Seminare für Führungskräfte gebe, dann starte ich gerne mit einer Frage: “Wer von Ihnen hat in den letzten 3 Jahren eine schlechte Führungskraft erlebt?” Es heben sich dann stets etwa ⅔ der Hände. Sie gehen schnell und weit in die Höhe.
Ineffektive und toxische Führung scheinen weit verbreitet, doch der Mensch wird nicht desinteressiert und lethargisch geboren. Der Führungsstil hängt auch vom eigenen Menschenbild ab. Sind wir anderen Menschen gegenüber misstrauisch, werden wir sie auch mit Misstrauen führen. Letztlich braucht es dann nicht zu verwundern, wenn solch eng kontrollierte Menschen allmählich desinteressiert und zynisch werden.
Allerdings hat sich das Bild der Führungskraft seit den 90ern gewandelt. Es wird mehr auf zentrale Faktoren der Führung, wie Vertrauen, Teilhabe und Offenheit, geachtet. Von Natur aus möchte der Mensch beitragen – und das stimmt mich hoffnungsvoll, obwohl noch ein weiter Weg zu gehen ist.
Warum sehen wir so viel schwache Führung?
Führung ist ein vielschichtiger Prozess. Um gut zu führen, muss man üben und so die eigene Führungsfähigkeit kontinuierlich verbessern. Das kommt in vielen Organisationen zu kurz. Auch einzelne Führungskräfte lassen, häufig getrieben von zeitraubenden technischen-inhaltlichen Aufgabenstellungen, die zwischenmenschliche Führung hinten runterfallen.
Dabei ist wieder das Menschenbild ganz entscheidend. Der Mensch ist mehr als ein Eigennutzmaximierer. Das ist nicht alles was wir sind. Dennoch wird ein positives Menschenbild in der Führung noch immer zu oft als naiv abgetan. Wer ‚professionell‘ sein will muss sich absichern, auf der Hut und politisch geschickt sein. Startups beginnen oft mit einem positiven Menschenbild – sind gerade deshalb für viele junge Menschen attraktiv – und müssen in der Wachstumsphase darauf achten, dass dieses Bild nicht verlorengeht.
Bild von Russ Ward auf Unsplash
Ein weiterer Grund für schlechte Führung sind die eigenen Führungsvorbilder. Mitarbeiter, die unter der Hierarchie und Führungsschwäche ihrer Institutionen leiden, werden später häufig ähnliche Führungspersönlichkeiten, wie ihre Chefs. Es wird kopiert und weitergegeben.
Dem kann man sich dann entziehen, wenn man seine eigene (Führungs-)Entwicklung selbst in die Hand nimmt und sich offen und ehrlich auf dem Weg macht, sich über die eigenen Werteprioritäten und das eigene Führungshandeln strukturiert Gedanken zu machen. Genau darauf zielt das Konzept der authentischen Führung ab. Wenn es uns gelingt Situationen und Menschen reflektierter zu betrachten, gewinnen wir auch in der Führung dazu.
Sie haben sich jetzt einige Jahrzehnte mit dem Thema Führung auseinandergesetzt, was hat diese Arbeit bei Ihnen persönlich bewirkt?
Man erlebt schon eine Reise. Ich bin dabei selbst reflektierter geworden und merke, dass ich in der Arbeit mit Forschungspartnern, Unternehmen und Führungskräften die Dinge noch ganzheitlicher betrachte. Meine Werte haben sich über die Zeit jedoch nicht verändert. Sie haben sich eher geschärft. Es ist mir klarer wofür ich stehe und ich kann Dinge, auch Dank meiner Arbeit, mit größerer Reflektiertheit vorantreiben.
Was würden Sie Führungskräften raten?
Ich würde Ihnen raten ihre Führungsrolle ernst zu nehmen und zur Priorität zu machen. Zu schnell nimmt Politisches und Technisches Überhand. Wenn es gelingt, Führung als persönliche und strategische Qualität Gewicht zu verleihen, ist der Weg zum eigenen Wachstum nicht mehr weit. Sie finden heraus, wer Sie als Führungskraft sind und was Ihr Stil ist – und können dann zielgerichteter und besser führen.
Mit Stil endete mein Interview mit Professor Högl. Ich lernte einen reflektierten Familienmenschen kennen, der sich um die Zukunft unserer Organisationen und Teams sorgt und kümmert. Als ich meine Kopfhörer absetzte, war mein Herzschlag ruhig. Die Aufregung war einer hoffnungsvollen Gelassenheit gewichen. Im Grunde möchte der Mensch beitragen. Ich machte den Bildschirm aus und sah mein eigenes Lächeln im Spiegelbild.